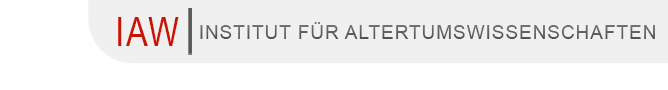Publikationen

Tagungsband, herausgegeben von Heide Frielinghaus, Jutta Stroszeck und Anne Sieverling in der Reihe Beiträge zur Archäologie Griechenlands, Band 8 Textilien sind nicht nur ubiquitär, sondern zeichnen sich auch durch Vielfalt, Funktionsbreite und Ambivalenzen aus. Der im November 2023 erschienene achte Band der Reihe ‚Beiträge zur Archäologie Griechenlands‘ setzt sich in einer Kombination aus archäologischem, restauratorischem und philologischem Zugriff mit grundsätzlichen Potentialitäten der Materialgruppe auseinander. Die Autoren des von Heide Frielinghaus, Anne Sieverling und Jutta Stroszeck herausgegebenen Werkes arbeiten ausgewählte Aspekte des Nutzungsspektrums anhand von Fallbeispielen heraus, die unterschiedlich kontextualisierte Objekte, Darstellungen oder/und schriftliche Quellen aus verschiedenen Gebieten des antiken Griechenland als Ausgangspunkt nehmen; zugleich setzen sich mehrere Beiträge auch mit Möglichkeiten und Herausforderungen auseinander, denen heutige Forscher/innen bei der Rekonstruktion von Befund, Funktion und Bedeutung gegenüberstehen. ...
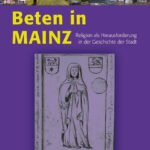
Im Lauf seiner 2.000-jährigen Stadtgeschichte war Mainz durch unterschiedliche Religionen geprägt. Der Sammelband, herausgegebenen von Nina Gallion und Johannes Lipps, nähert sich den zahlreichen religiösen Herausforderungen im urbanen Kontext. Dabei wird der Blick auf Einzelschicksale Mainzer Bürger*innen gerichtet, die sich in Texten, Bildern und materiellen Hinterlassenschaften niederschlugen. Sie berichten von vielseitigen Hoffnungen und Ängsten. Erscheint am 11.12.2023 beim Nünnerich-Asmus Verlag in Oppenheim. ...

Im dritten MAPA-Band (Material Appropriation Processes In Antiquity) wird die im Oktober 2020 im Mainzer Zollhafen gefundene Salus bekannt gemacht. Über Jahrhunderte hinweg unter Bauschutt begraben, weist die Statue einen erstaunlich guten Erhaltungszustand auf und zeugt von einer bemerkenswerten handwerklichen Qualität. In ausführlichen Studien wird der Statuenfund nun erstmals von einem Autorenkollektiv um Johannes Lipps, Detlev Kreikenbom und Jonas Osnabrügge vorgestellt und eingeordnet. Erscheint am 15. Januar 2024 beim Reichert-Verlag in Wiesbaden. ...
Alexander Ilin-Tomich, Egyptian Name Scarabs from the 12th to the 15th Dynasty. Geography and Chronology of Production (Contributions to the Archaeology of Egypt, Nubia and the Levant), Wiesbaden 2023. Das Mittlere Reich und die Zweite Zwischenzeit waren die Blütezeit der Namenskarabäen in Ägypten. Hunderte von Skarabäen und deren Abdrücke mit den Namen von ägyptischen Herrschern und nichtköniglichen Personen sind bekannt; damit sind Siegel die zahlreichste und eine der wichtigsten Gruppen von Schriftquellen dieser Epoche. Das Buch von Alexander Ilin-Tomich erkundet die Forschungswege, die sich durch die Gegenüberstellung der ausgewerteten Skarabäeninschriften und der stilistischen und typologischen Beobachtungen eröffnen. Das Buch zielt auf die Rekontextualisierung dieser kleinen zierlichen Objekte, die größtenteils aus undokumentierten Massenplünderungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts stammen. Die Studie bietet neue Ansätze zur chronologischen und geographischen Zuordnung der Skarabäen des Mittleren Reiches und untersucht unterschiedliche Modelle der Skarabäenherstellung. Sie leistet Beiträge zu den laufenden Diskussionen über die ...
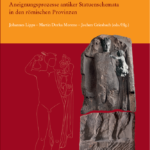
Antike Statuen lassen sich anhand ihres charakteristischen Erscheinungsbilds größtenteils in Gruppen ordnen. Eine solche Gruppe bezeichnen wir in diesem Band als Schema. Viele Statuenschemata wurden über Jahrhunderte hinweg in immer neuen Versionen tradiert und zugleich in verschiedene materielle, räumliche und funktionale Kontexte überführt. Zugrunde lag dem stets ein Prozess kreativer Aneignung, dessen Grad an Reflexion allerdings unterschiedlich hoch ausfallen konnte. Manche Verarbeitungen behielten die einstigen Sinnzusammenhänge ihrer Vorbilder mehr oder weniger bei, andere wurden mit gänzlich neuen Bedeutungszuschreibungen versehen. – Ziel des vorliegenden Buches ist es, die dynamischen und transformativen Kräfte solcher Rezeptionsprozesse an ausgewählten Beispielen aus den Provinzen des römischen Reiches sichtbar zu machen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den jeweiligen sozio-kulturellen Rahmenbedingungen und Kommunikationsgewohnheiten, die voneinander abweichende, aber auch wiederkehrende Mechanismen und Strategien im Umgang mit statuarischen Vorlagen erkennen lassen. Beabsichtigt ist so ein Perspektivwechsel, der es erlaubt, überkommenen Polarisierungen wie ‚Original‘ und ‚Kopie‘, ‚griechisch‘ und ‚römisch‘ oder ...
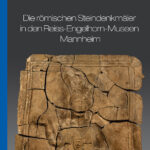
Die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim beherbergen eine der bedeutendsten Sammlungen römischer Steindenkmäler in Deutschland. Dass diese wichtige archäologische Sammlung bis heute nicht umfassend dokumentiert und publiziert wurde, liegt an ihrem wechselvollen Schicksal, vor allem an der partiellen Zerstörung durch Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg. Damals wurden viele Objekte so stark beschädigt, dass sie seither nach ihrer provisorischen Bergung in Magazinen unter der modernen Stadt ein verborgenes Dasein fristeten und ihr Zustand unbekannt war. Mit dem vorliegenden Band wird diese Sammlung nun erstmals in größtmöglicher Vollständigkeit dokumentiert. Die vorgestellten Inschriftenmonumente, Skulpturen und Architekturglieder stammen hauptsächlich aus der Umgebung von Mannheim sowie aus der überregionalen Sammeltätigkeit der Kurfürsten. Sie gaben Anlass zu neuen Forschungen, die unsere Kenntnis über die römische Epoche im Rhein-Neckar-Raum auf eine neue Grundlage stellen. Der Katalog ist 2021 beim Verlag Regionalkultur erschienen. Hrsg. von Johannes Lipps (JGU Mainz), Stefan Ardeleanu, Jonas Osnabrügge, Christian Witschel (alle Universität ...

In der zweibändigen Veröffentlichung präsentieren Ursula Verhoeven, unter Mitarbeit von Svenja A. Gülden, die reichhaltigen Texte und Eva Gervers die kunstfertigen Zeichnungen, die antike Besucher im Grab N13.1 (ca. 2000 v. Chr.) auf dem mittelägyptischen Nekropolenberg von Assiut hinterlassen haben. Sie stammen aus der Zeit des Neuen Reiches (um 1550-1100 v. Chr.) und zeugen von historischem Bewusstsein, Selbstdarstellung der Schreiberelite, literarischer Bildung und schulischer Ausbildung, aber auch von Verehrung der Vorfahren und der lokalen Götter sowie einer Hoffnung auf Wohlergehen und zahlreiche Opfergaben. Youssef Ahmed-Mohamed betrachtet zudem die Texte und Zeichnungen aus islamischer Zeit, die z. T. ganz ähnliche Motive der späteren Grabbesucher offenlegen. Das Werk ist ab sofort im Harrassowitz Verlag erhältlich. ...

Das Institut für Altertumswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität lässt auch das Jahr 2019 Revue passieren und stellt ausgewählte Forschungstätigkeiten, Grabungsprojekte und Aktivitäten seiner Mitglieder vor. Auf 172 Seiten präsentieren sich die Arbeitsbereiche Ägyptologie, Altorientalische Philologie, Klassische Archäologie, Klassische Philologie, Vorderasiatische Archäologie, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie sowie die Verbundprojekte Graduiertenkolleg 1876 „Frühe Konzepte von Mensch und Natur“, Interdisziplinärer Arbeitskreis “Alte Medizin“ und LOB-Projekt. Der Bericht ist bei Zenodo publiziert und kann dort unter stabiler DOI heruntergeladen werden: http://doi.org/10.5281/zenodo.3873037 Bibliografische Angaben: Walde, Christine, Gerhards, Simone, & Reitze, Bastian. (2020). Jahresbericht 2019 des Instituts für Altertumswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3873037. ...

Univ.-Prof. Dr. Verhoeven-van Elsbergen (JGU) und Univ.-Prof. Dr. Kahl (FU Berlin) berichten in einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung über die langjährigen Forschungen des Asyut Projects auf dem Gräberberg von Assiut. Der Artikel vom 05. Juni 2020 ist unter https://www.sueddeutsche.de/wissen/ausgrabung-forscher-archaeologie-1.4927182 einzusehen. Foto: Fritz Barthel ...

Das Institut für Altertumswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität lässt auch 2018 das Jahr Revue passieren und stellt ausgewählte Forschungstätigkeiten, Grabungsprojekte und Aktivitäten seiner Mitglieder vor. Auf 175 Seiten präsentieren sich die Arbeitsbereiche Ägyptologie, Altorientalische Philologie, Klassische Archäologie, Klassische Philologie, Vorderasiatische Archäologie, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie sowie die Verbundprojekte Graduiertenkolleg 1876 "Frühe Konzepte von Mensch und Natur", Interdisziplinärer Arbeitskreis "Alte Medizin" und LOB-Projekt. Der Bericht ist diesmal bei Zenodo publiziert und kann dort unter stabiler DOI heruntergeladen werden: http://doi.org/10.5281/zenodo.2650962 Bibliografische Angaben: Walde, Christine, Gerhards, Simone, & Weiß, Adrian. (2019). Jahresbericht 2018 des Instituts für Altertumswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2650962. ...